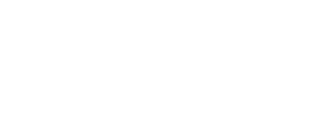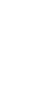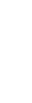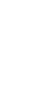Heimat ist keine heile Welt

„Heimat ist keine heile Welt“
Ein Interview mit Edgar Reitz
Sie sind als Regisseur mit dem Filmepos Heimat bekannt geworden.
Was hat Sie veranlasst, sich mit dem Thema Heimat auseinanderzusetzen?
Die Heimatlosen sind die Glückssucher,
die Neudenker, die Schöpferischen.
Es ging mir nicht darum, das Thema Heimat gedanklich oder abstrakt aufzuarbeiten
und dann einen Film zu machen. Am Anfang stand vielmehr eine Erzählung.
Ende der 70er Jahre hatte ich bereits acht Spielfilme gemacht. Es kam der Moment, in dem ich
mich fragte, aus welchen Quellen ich schöpfe. In dieser Zeit fing ich an, meine Familiengeschichte
aufzuschreiben. Meine Absicht war, herauszufinden, wie es dazu kam, dass ich als Kind einer
Handwerkerfamilie ein Filmemacher wurde. Ich bin im Hunsrück geboren; die Großeltern
mütterlicherseits waren Bauern. Die Vorfahren meines Vaters Dorfschmiede, also Handwerker
in der siebten, achten Generation. Mein Vater hatte die grobe Form der Metallverarbeitung
in die allerfeinste Form umgewandelt: Er war Uhrmacher geworden. Sein Sohn wurde Filmemacher.
Irgendwie war mir diese Entwicklung innerhalb zweier Generationen rätselhaft.
Dem Wollten Sie auf den Grund gehen?
Heimatvertriebenen hat man die
Entscheidung zu gehen weggenommen.
Genau. Ich fing an, die Geschichte meines Großvaters zu erzählen; die Geschichte des Dorfschmieds.
Und während ich sie aufschrieb, merkte ich, dass ich mir meinen Großvater neu erschaffe. Ich
habe die Figur kreiert. Der ganze familiäre Umkreis, der eine bestimmte Atmosphäre wiedergab,
verwandelte sich mehr in Fiktion. Da ich gewohnt war, im fiktiverzählerischen Bereich zu arbeiten,
gefiel mir das. Meine Aufgabe sah ich darin, die Familiengeschichte authentisch aufzuschreiben,
das können auch andere machen. Ich wollte mit den Mitteln der Erzählkunst in das Gewirr der
Zeitgeschichte eindringen. Und dabei wurde mir nicht nur die eigene Familie interessant, sondern
überhaupt der Lebenszusammenhang, das Leben in ländlichen Regionen zu dieser Zeit, das Dorf,
die Zeitgeschichte, des 20. Jahrhundert mit all seinen Wandlungen. Das Wort „Heimat“ spielte
dabei gar keine Rolle.
Was hat Sie dann dazu bewogen, den Titel
Heimat für Ihre Filmerzählung zu wählen?
Ich hatte natürlich von Anfang an das Bedürfnis, einen geeigneten Titel zu finden.
Im Hunsrücker Dialekt gibt es ein Wort, das mir sehr gefällt. Das Wort heißt: Geheischnis.
Dieses Wort ist in fast allen deutschen Mundarten unbekannt. Allein im Saarland hört man es
noch. Dieses Wort kommt aus der landwirtschaftlichen Lebenserfahrung und leitet sich her
von „hegen“. Ein Geheischnis ist eine Umfriedung, ein umhegter Raum. Im übertragenen
Sinne meint es Geborgenheit und menschliches Vertrauen.
Als es daran ging, den Film zu realisieren, merkte ich, dass dieses Wort nicht kommunizierbar
war. So hat man nach Analogien gesucht, auch klanglichen, und kam auf „Heimat“.
Gegen diesen Titel habe ich mich zunächst aber gewehrt. Dieses Wort ist assoziativ belastet
mit Naziideologie, mit „Blut und Boden“, mit Romantik und pseudofolkloristischen
Vorstellungen, wie die Tourismusindustrie sie produziert. Ich war der Meinung, dass ein
Filmemacher gegen diesen wüsten Berg von historischem Schutt machtlos ist.
Während der gesamten Produktionszeit habe ich versucht, das Wort „Heimat“ zu meiden.
Drei Monate während der Produktion waren wir der Meinung, wir sollten den Film
Made in Germany nennen. Als die ersten 16 Stunden fertig waren, gab es in München eine
interne Vorführung. Dort haben mir Freunde dazu geraten, den Titel „Heimat“ zu wählen.
Die Fernsehredaktion war aber zunächst noch vehement gegen diese Titelwahl.
Erst nach monatelangen Diskussionen haben wir dann mit digitalen Mitteln in goldenen
Lettern das Wort „Heimat“ auf den Hunsrücker Felsstein gesetzt, der im Vorspann der einzelnen
Episoden zu sehen ist und auf dem noch der Arbeitstitel Made in Germany eingraviert war.
Kann man belastete Begriffe wie „Heimat“ neu bestimmen,
das Unabgegoltene in Ihnen zum Vorschein bringen?
Das geht nicht per Absichtserklärung. Das kann nur gelingen, wenn das Werk die Kraft hat,
den vergangenen Schutt wirklich runterzufegen. Das 16 stündige erste Epos hat glücklicherweise
diese Kraft, sonst wäre der Film unter seinem Titel erstickt. Aber heute, nachdem über 25 Jahre
vergangen sind, bin ich dennoch oder wieder, im Zweifel. Es gibt ja keinen Begriff, der derart
im Munde aller und zum Modebegriff geworden ist wie „Heimat“. Dies ist ein Hinweis auf die heutigen Unsicherheiten mit unserer Nation. Man würde sich mit „Heimat“ gerne ein kleines
Stück Unschuld erobern in unserer so befleckten, nationalen Geschichte.
Ist mit Heimat nicht auch eine Sehnsucht,
so etwas wie „Heimweh“ verbunden?
Die erste Episode von Heimat trägt den Titel „Fernweh“.
Das ist das Gegenteil von Heimweh, der Wunsch, den Horizont der Kindheit zu verlassen.
Ich hätte nie in meiner Heimat bleiben können. Aus allem, was ich über Familie,
Vorstellungswelt und Mentalität der Menschen wusste, war mir klar: die Heimat setzt mir
nur Grenzen, unterdrückt mich in vielerlei Hinsicht. Ich hätte nicht glücklich werden können,
wenn ich in meiner Heimat geblieben wäre. Und so ist es offensichtlich auch über
Jahrhunderte hinweg immer wieder Menschen ergangen.
Das eigene Leben ist ein Kunstwerk.
Im 19. Jahrhundert sind hunderttausende von Deutschen aus ihrer Landschaft fortgelaufen,
meist in die neue Welt, meist aus wirklich guten Gründen. Heimat war zu einem Synonym
für Chancenlosigkeit und Enge geworden. In dem deutschen Wort „Heimat“ schwingt vor
allem die Erfahrung mit, dass man sie verlässt oder verloren hat.
Wenn man sie durch äußere Einwirkung und ohne eigenes Dazutun verliert, bleibt ein Schmerz
des Verlustes zurück. Aber ich glaube, der Verlust, den man dabei erleidet, ist vor allem
der Verlust der Hoffnung, sie verlassen zu können – so widersinnig das klingt.
Heimatvertriebene werden insofern verletzt, als man ihnen die Entscheidung zu gehen
weggenommen hat. Natürlich ist in dieser Entscheidung auch die Möglichkeit des Bleibens
enthalten. Entscheidung heißt immer, dass man beide Möglichkeiten hat. In vielen Fällen
aber haben sich Menschen freiwillig entschieden die Heimat zu verlassen.
Deswegen gibt es Großstädte, die Ballungsräume und Industriezentren, die sich aus der
Landflucht genährt haben. Die Weggeher, die Wegläufer sind die Hefe der Welt.
Sie haben die Dinge in Gang gebracht. Die Heimatlosen sind die Glückssucher, die
Neudenker, die Schöpferischen.
Aber es gibt doch auch Menschen, die von
der Großstadt aufs Land ziehen?
Das ist das Aussteigertum, das haben wir seit den 60er Jahren. Menschen , die
Zivilisationsmüde sind, meinen, wenn sie ihre Karotten selber pflanzen, Biogemüse
essen und so weiter, kehren sie zurück zu den Quellen. Aussteigertum ist eher ein
Ausdruck von Ratlosigkeit. Auf dem Land schicken die Eltern heute ihre Kinder zum
Studieren in die Großstädte. Die Landbevölkerung selber glaubt nicht mehr an das
traditionelle Landleben.
Woraus nährt sich das Heimweh,
ist es nur ein sentimentales Gefühl?
Heimweh nähert sich aus der Kindheit, die immer voller Versprechungen ist, die sich noch
nicht erfüllt haben und deshalb mit einer Fülle von Wundergefühlen verbunden sind.
Da ist Weihnachten noch etwas wirklich etwas, was die Herzen bewegt. Dieses Weihnachtsgefühl
gegenüber Familie, Landschaft, Menschen und Gewohnheiten trägt man insgeheim mit sich ins
Erwachsenenalter. Es erzeugt einen Schmerz, den wir gern Heimweh nennen.
Aber es ist eine Selbsttäuschung, denn gerade dieses Heimweh erlaubt uns keine Heimkehr.
Das habe ich auch in meinem Film beschrieben. Da ist zum Beispiel Paul, der mit diesem
Merkwürdigen Gefühl aus Amerika zurückkehrt, dass die Schlappen noch da stehen, wo man sie ausgezogen hat, dass man, wenn man friert, zur Mutti unter die Decke krabbeln kann.
Heimat ist für die meisten
Menschen eine Utopie.
Dieses Gefühl ist natürlich eine riesige Täuschung. Dennoch glaube ich, dass sich das Heimweh
In eine produktive Kraft umwandeln kann, insofern sich daraus ein Maßstab herleiten lässt.
Ich komme auf das Wort Geheischnis zurück, das sehr genau bezeichnet, welche Sehnsucht
Da im Inneresten schwingt: das Verlangen nach Geborgenheit, auch im Sinne von Unantastbarkeit
und Unverletzbarkeit, das Verlangen nach Übersichtlichkeit der Beziehungen und Verhältnisse.
Das ist freilich eine Utopie. Aber wir wissen ja von den Utopien, dass sie produktive
Deckanstöße liefern, Kreativität freisetzen. Ebendiese Gefühle haben mich befähigt, meine
Filme machen zu können, Heimat im Film zu schaffen.
Was verlässt man, wenn man die Heimat verlässt?
Kann man das „Geheischnis“ nicht mitnehmen?
Als Tatsache, als Realität kann man es nicht mitnehmen. Ja, die Fragestellt sich, ob man es je
hatte. Natürlich war man ein umhegtes Kind, man hatte eine Mutter, eine Großmutter,
man hat ganz bestimmt schöne Erinnerungen, aber es gab auch Verletzungen, Zeiten der
Hoffnungslosigkeit. Hat man erst einmal den Absprung geschafft, ist die Auseinandersetzung
mit den Widerwertigkeiten der Kindheit, der Heimat zu Ende.
Für mich war die Heimat ein endlos unter wirtschaftlichen Notverhältnissen leidender
Handwerkerhaushalt in den 50er Jahren. Jede zweite Woche kam der Gerichtsvollzieher, der
irgendwelche Zahlungen eintreiben musste. Zudem fand man in diesem Umfeld keine
Gesprächspartner. Ich interessierte mich für Literatur, für Kunst, für Kino und für alles
Kulturelle. In einer Welt, in der jeder jedem über den Gartenzaun blickte, sehnte ich mich
nach dem Leben in der Großstadt, wo man den Nachbarn nicht zur Kenntnis nimmt.
Die verbreitete Kritik an der Anonymität des Großstadtlebens ist ja nicht immer gerechtfertigt.
In den Dörfern, wo jeder jeden kennt, herrscht der Terror.
Nicht alles kann Heimat werden.
Da hasst man sich auch und führt permanent ein Doppelleben. Meine Eltern haben
es zum Beispiel fertig gebracht, bis Mitte der 60er Jahre vor ihren Nachbarn und dem
ganzen Ort zu verbergen, dass es ihnen wirtschaftlich schlecht ging. Sie haben es immer
geschafft die Fassade aufrechtzuerhalten und als wohlhabend zu gelten.
Auf dem Land gibt es nur eine Wertschätzung: Die Besitzenden sind die besseren Leute-
das ist brutal.
Vilém Flusser definiert Heimat als Summe der Menschen,
für die er Verantwortung trägt.
Das Engagement des Citoyen – schafft das Heimat?
Verantwortung ist eine moralische Kategorie. Was heißt Verantwortung übernehmen?
In einer anonymen Gesellschaft ist Verantwortung abstrakt. Man kann höchstens sagen,
letztlich handelt es sich um meinen Vor- oder Nachteil. Wenn zum Beispiel das
Gesundheitswesen nicht funktioniert oder wenn der Straßenverkehr nicht funktioniert,
ist das zu meinem persönlichen Nachteil, also engagiere ich mich.
Das größte Bedürfnis der Menschen ist das Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit, nach
Zugehörigkeit. Wenn ich zum Beispiel bestimmte Jacken trage, dann entscheide ich mich
im Sinne einer Zugehörigkeit. Ich will zu denen gehören, die solche Jacken tragen.
Der Markterfolg bestimmter Produkte entsteht nicht durch ihre Qualität, sondern durch die
Zusammengehörigkeitsbedürfnisse, die sie mobilisieren. Man ist immer auf der Suche nach
gemeinsamen Erfahrungen.
Freilich ist in den Großstädten das Verlangen der Zusammengehörigkeit und der Dazugehörig-
keit stärker entwickelt als auf dem Land. Auf dem Land ist der Zustand von vorneherein gegeben
und man wird oft versuchen, ihn abzuschütteln. In den Großstädten, wo die Alternative
die Einsamkeit ist, nimmt man an allem Möglichen teil, das Vereinsleben blüht.
Ist die Rede von der Heimat nicht oft nur der Versuch, eine
Vergangenheit zu erschaffen, die so gar nicht stattgefunden hat?
Das ist wahr. Wenn ich zum Beispiel hier in München denke: Ein wesentlicher Teil des kollektiven Gedächtnisses dieser Stadt sind die Zerstörungen durch den Krieg. Gerade die Stadt München
hat sich aus einer Art Konsens des konservativ-bayrischen Bürgertums dazu entschlossen, diese
Erinnerungen zu tilgen – etwa durch die Neubebauung und durch einen Konservativismus,
der so tut, als wäre das alles Kontinuität. Wenn sie durch München laufen, haben sie dauernd
den Eindruck, Sie gehen durch eine historische Stadt. Aber die meisten historischen Gebäude
dieser Stadt wurden nach dem Krieg nachgebaut. Das schöne historische Stadtbild ist
architektonische Fiktion.
Eine Heimatfiktion?
Ja.
Braucht Heimat einen Ort? Kann man auch eine
Großstadt oder einen Wohnwagen als Heimat empfinden?
In der Großstadt gibt es so etwas wie Heimat im ursprünglichen Sinne nur selten. Wir gehen
einfach zu weit, wenn wir fordern, dass alles Heimat werden kann. Es ist doch überall
Heimat. Wenn wir von Heimat sprechen, dann sprechen wir immer von einem wirklich
konkreten Raum, der durch persönliche Erfahrungen begrenzt ist. Ein Wohnwagen ist
keine Heimat. Das ist doch kein aus einer Biografie begründeter Gegenstand, sondern
irgendein Objekt, das man gekauft hat. Man kann Heimat nicht besitzen, und man kann sie
auch nicht machen. Heimat kann nie ein Raum sein, der nur politisch oder nach
Verwaltungsbezirken definiert ist. Nötig ist etwas das Vertrauen und Vertrautheit
erzeugt, zum Beispiel die Sprache. Mundart begrenzt in jedem Falle Heimat;
schon an der Aussprache kann man mitunter die Grenze zum Nachbarort erkennen.
Für viele Leute ist die Kirchturmspitze, die als Wahrzeichen über die Felder ragt, Heimat.
Auch Landmarken haben etwas Magisches , weil sie immer unangetastet bleiben.
Bauern sind ja gnadenlos: wenn ihnen irgendetwas im Wege steht, wird es weggehackt
oder beseitigt. Sie haben selten Respekt vor der Schönheit der Dinge. Sie haben keinerlei
Respekt vor irgendwelchen Dingen, weil sie schön sind. Aber ein solcher magischer Gegenstand
bleibt stehen – Bäume, die tausend Jahre alt sind, oder ein von Hecken überwuchertes
kleines Hügelchen, das nie einer versucht hat zu nutzen. An den Küsten hat man Leuchttürme oder einen eigentümlich geformten Felsen. Solche Wiedererkennungspunkte, die sich in den Köpfen einprägen, sind Heimat im engeren Sinne.
Natürlich ist das Landleben heute durch die Medien, die neuen Informationsmöglichkeiten
anders geworden. Man weiß, dass die Welt hinter dem Acker nicht zu Ende ist. Die
Weltwahrnehmung findet heute nicht mehr mit den eigenen Augen und den eigenen Sinnen
statt, sondern sie wird durch die Medien vermittelt. Und die Wahrnehmung über die Medien
Erscheint uns realer als die direkte, da sie gesellschaftlich unterfüttert ist.
Kann man sich im Internet eine virtuelle
Heimat gestalten?
So etwas macht mir geradezu apokalyptische Albträume. In Internetspielen wie Second Life,
bei denen Millionen Menschen sich im virtuellen Raum eine fiktive Identität geben und eine
Pseudodenkwelt bauen, gelten die üblichen Gesetze nicht mehr, selbst die Naturgesetze
sind weitgehend außer Kraft gesetzt. Stanislaw Lem schildert in seinem Science-Fiction-Roman
eine vollkommen mediale Welt. Glückstropfen werden durch die Wasserleitung verabreicht
und alle visuellen und sinnlichen Wahrnehmungen der Welt sind nur noch durch die Medien
vermittelt. In Wirklichkeit erstickt die Welt in Schrott, Müll und Schmutz und jegliche
Kultur geht unter; aber die Menschen sind glücklich, weil sie das alles nicht mehr wahrnehmen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Welt sich so entwickeln wird. Es gibt ein Regulativ
für unser Verhältnis zur Welt: das Wissen, dass wir sterblich sind. Die Gewissheit des Todes tragen wir von Kindheit an in uns. Das macht einen ganz wesentlichen Teil unseres Weltverständnisses
aus. Daran können die Medien nichts ändern. Und deswegen bleibt das Verhältnis zum Körper
und mit dem Körper das Verhältnis zum Ort die eigentliche, natürliche Bedingung der
menschlichen Existenz. Noch nicht einmal in unseren Träumen koppeln wir uns ganz vom
Körper ab. Die virtuelle Welt wird der realen immer ähnlicher aber nicht umgekehrt.
Es wird nicht so werden, dass diese Virtualitäten hinterher irgendwo im realen Leben
weiteregelebt werden können. Second Life ist nur ein Rückschlag um Jahrhunderte oder
Jahrtausende, weil die Spielregeln des realen Lebens da noch nicht erfunden sind. Die müssen
sie sich langsam wieder erarbeiten, bis sie durch all diese Irrtümer, die wir historisch längst überwunden haben, dann doch wieder in der Gegenwart ankommen. Die Leute, die in
Second Life leben, können mir nur leid tun, weil sie unglaublich viel Zeit verlieren – sie verlieren
ihr persönliches Schicksal.
Die Sinti und Roma, oft als Zigeuner beschimpft, haben ebenso wie
die Nomaden eine Heimat, die aber nicht an einem festen Ort gebunden sind.
Auch heute gibt es Menschen, die die Lufthansa-Lounge, den ICE oder die
immer gleich ausgestatteten Hotelzimmer als Heimat empfinden.
Warum werden die Nichtsesshaften von den Sesshaften so beargwöhnt?
Die sesshaften Völker und die nomadisierenden Völker haben sich in der Geschichte nicht
vertragen, weil die einen von dem leben, was sie vorfinden, und die anderen es auf
sich nehmen, Ackerbau zu betreiben, und auf ihre Ernte warten. Dass man in den Dörfern,
die im Film als Horte der Sesshaftigkeit beschrieben werden, Vorurteile gegen das
fahrende Volk hatte – das musste ich erzählen, weil es wahr ist.
Aber man darf die moderne Tourismusmobilität nicht fehlinterpretieren als modernes
Nomadentum. Die Urlauber und Weltreisenden verdienen alle ihr Geld da, wo sie wohnen,
und wenn sie keinen „sesshaften“ Job haben, ist auch die Lufthansa-Lounge ganz schnell
zu Ende.
Hat Heimat etwas mit der Schönheit der
ländlichen Natur zu tun?
„Natur“ ist eines der größten Missverständnisse unserer Zeit, denn eigentlich ist die Natur
nicht kuschelig. Die Sehnsucht nach einer sicheren Lebensmitte äußert sich oft in einem
Verlangen nach landschaftlicher Schönheit. Die heutige Suche nach Idyllen, die auch
durch den Tourismus angeheizt wird, führt zu dem Missverständnis, dass Heimat
etwas Schönes sei. Und dann baut man sich irgendwo ein Haus an einem schönen
Ort und wundert sich darüber, dass man dort keine Wurzeln schlägt und dass man sich
dort gegenseitig auf die Nerven geht. Im Traumhaus halten Ehen meist nicht lange.
Erzählen Sie in Ihren Filmen Geschichte
oder Geschichten?
Ich habe nie dokumentarische Mittel angewendet, weil ich ihnen misstraue.
„Genau so war`s“ sagt man fast immer nur dann, wenn der Film nicht fähig ist, die
innere Wahrheit zu erfassen. Die Ähnlichkeit mit dem Leben entsteht für mich erst durch
Übersetzung in Formenwelt der Erzählkunst. Zum Beispiel die Großmutter in Heimat.
Sehr viele Leute haben gesagt: „Ja, so war auch meine Großmutter!“ Hätte ich
meine Großmutter nur dokumentarisch porträtiert, wäre dieses Gefühl nie entstanden.
Ich habe diese Großmutter kreiert, sie ist eine fiktive Figur, die Eigenschaften hat, die ich
gerne in ihr entdecken wollte. Da ist der Wunschtraum einer Großmutter verfilmt,
die Liebe zu einer solchen Figur. Ein Porträt der Liebe. Das macht sie universell.
Ist Ihr Film, ist Kunst autobiografisch?
Im tiefen Sinne ja. Ein Kunstwerk ist ein persönlicher Ausdruck. Der Urheber, der Autor
Ist mit seinem Leben nie ganz aus dem Werk wegzudenken. Kunst ist nicht dazu da,
um wahr zu sein. Der Film ist ja mehr als nur irgendeine Form von Bildergeschichte,
er ist eine eigene Sprache. Die filmischen Mittel sind eben so umfassend wie die der
Literatur. Ich habe das Handwerk des Filmemachens gelernt, und wenn ich einen
Film mache, dann äußere ich mich in dieser Sprache. Menschen gestalten ihre Biografie,
sie wird einem ja nicht geschenkt. Der Mensch wird zweimal geboren. Einmal aus seiner
Mutter und zum zweiten Mal aus seiner Biografie. Diese Biografie ist harte Arbeit,
wir stricken ein Leben lang daran. Aber insofern wir an unserer Biografie arbeiten,
sind wir keine Künstler. Das eigene Leben ist kein Kunstwerk. Und da, wo diese
Verwechselung auftritt, wird die Kunst schlecht. Wenn das Werk unter Verdacht gerät,
geschaffen worden zu sein,
In den Dörfern, wo jeder jeden kennt,
herrscht der Terror.
um die Biografie des Autors damit zu schmücken oder zu gestalten, dann muss es in
Bezug auf seine künstlerische Substanz in Zweifel gezogen werden.
Auf der anderen Seite gibt es keine Kunstwerke, in denen sich das gelebte Leben des
Autors nicht widerspiegeln würde. Ohne mit dem Satz unserer gemachten Erfahrungen
aufgefüllt zu sein, kann keine unserer Äußerungen stark sein. Ich glaube, dass es so
etwas wie „unschuldige Zustände“ gibt, in die ein Künstler geraten kann. Es sind Momente
, in denen die bewusste Kontrolle verloren geht und wo Einfälle oder Lösungen aus dem
Nichts zu kommen scheinen.
Sind Sie durch Ihre filmische Auseinandersetzung
Mit dem Thema Heimat sozusagen heimgekommen?
Der Film ist viel, viel realer als meine tatsächliche Heimat. Im konkreten Sinne habe ich
mich durch die Filmarbeit abgenabelt; meine Heimat ist in dem Film abgetrauert und
abgelebt. Der Hunsrück, diese Landschaft, in der ich einst Kind gewesen bin, mit all
ihren familiären Bezügen und so weiter, ist nach Beendigung dieser Filmarbeit zur
Metapher geworden. Das habe ich sozusagen in bewegte Bildsequenzen umgewandelt,
und ich bin heute nicht mehr in der Lage, zu unterscheiden, was ist Film und was ist
Urerfahrung. Meine erste Liebe, meine erste Freundin im Alter von 17 Jahren – das ist
alles verschwunden. Natürlich weiß ich noch, wie sie geheißen hat, aber das hat sich alles
in eine Filmfigur umgewandelt. Auch meine Kindheit hat sich in Fiktion verwandelt.
Weil die Hunsrücker sehr stolz auf mich und die Heimat-Filme sind, hat man mir einmal
angeboten, dort zu leben. Die Gemeinde wollte mir günstig ein wunderschönes
Grundstück verkaufen. Aber ich nehme das nicht an. Lieber lebe ich, umgeben von fremden
Menschen, hier in München.
Herr Reitz, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Erschienen ist das Interview in der Zeitschrift der blaue Planet,
das Interview führten Elke Uhl, Stefan Gammel und Siegfried Reusch.